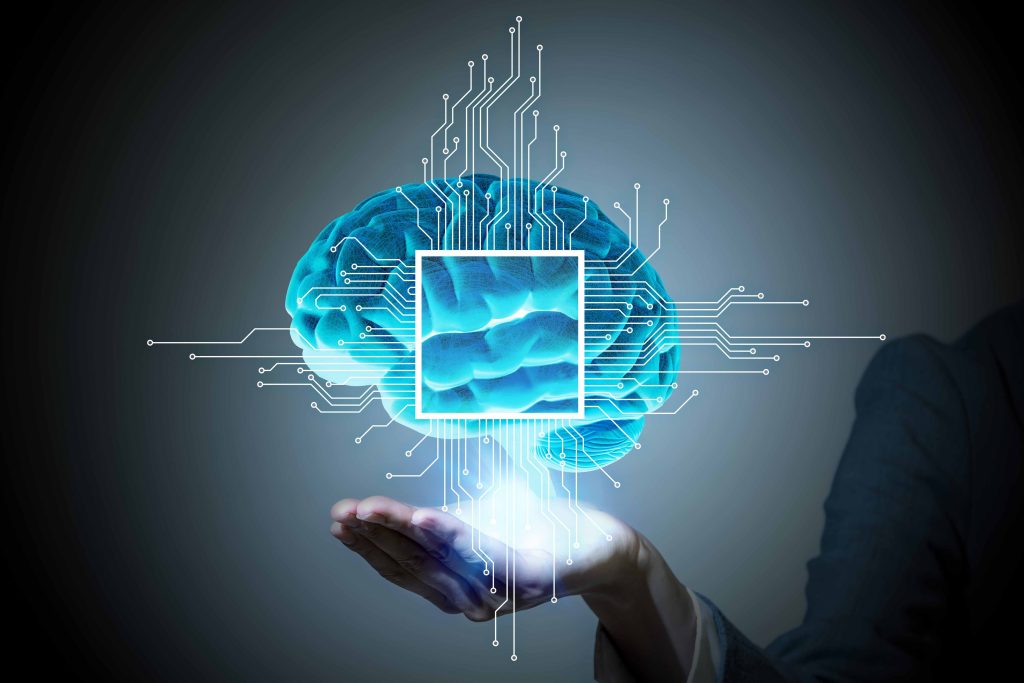Resiliente Wertschöpfung | Resilienz in der Automobilproduktion
„Gemeinsam besser werden und smarter zusammenarbeiten! – Resiliente Wertschöpfung am Beispiel der Automobilproduktion

In diesem Beitrag werden, ausgehend von den Begriffsklärungen und wissenschaftlichen Betrachtungen zur „individuellen und organisationalen und Resilienz“ die Voraussetzungen und Ziele der resilienten Wertschöpfung, insbesondere in Krisensituationen erläutert. Gleichzeitig werden neue Arbeitsmethoden, wie „Workhacks“, Teamlabs“ sowie „Lern- und Experimentierräume“ vorgestellt und deren Wirksamkeit bei der Etablierung von systemischer Resilienz im Unternehmen betrachtet. Ein Praxisbeispiel aus der Automobilindustrie zur erfolgreichen Einrichtung eines Experimentierraumes untersetzt die theoretischen Ausführungen.
Die Kombination aus Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit wird heute oft unter dem Begriff Resilienz zusammengefasst, der sich aber insgesamt in den letzten Jahren zu einem wahren Modebegriff entwickelt hat und in vielen Zusammenhängen verwendet wird. Allerdings ist nicht immer ganz eindeutig, was darunter zu verstehen ist – je nach Verwendung ließe er sich verstehen als Widerstandskraft, Belastbarkeit, Problemlösungsfähigkeit, Flexibilität oder Elastizität und vieles mehr. Es gibt also keinen echten Konsens über den Begriff. (Hoffmann, G. P: Organisationale Resilienz – Grundlagen und Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger und Führungskräfte. Springer Fachmedien Wiesbaden 2016)
Zur Betrachtung einer resilienten Wertschöpfung in der Automobilproduktion gehört zwingend auch die Betrachtung organisationaler und individueller Resilienz. Als Resilienz versteht man im Allgemeinen die Fähigkeit sozio-technischer Systeme, Schocks und Störungsereignisse zu absorbieren, Kernfunktionalitäten aufrecht zu erhalten bzw. schnell wieder herzustellen, aus Erfahrungen zu lernen und sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen.
Diese Anpassungsfähigkeit offener Systeme ist überlebenswichtig, wenn Prognosen nicht möglich oder sinnvoll sind und damit proaktives Handeln ausscheidet.
Individuelle Resilienz entwickelt sich einerseits naturgemäß durch die Bewältigung der Höhen und Tiefen unseres Lebens. Andererseits kann man Resilienz gezielt trainieren, denn bei Resilienzfaktoren handelt es sich nicht um angeborene Persönlichkeitsmerkmale. Die einzelnen Faktoren sind jedoch bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Wer sich initiativ auf den Weg macht, um seine schwächeren Resilienzfaktoren auszubauen, sorgt für mehr Zufriedenheit in seinem Leben und mehr Gesundheit.
Organisatorische Resilienz sorgt einerseits für eine nachhaltige Ausrichtung auf den Kunden, anderseits für den Erhalt und die Entwicklung der wichtigsten Ressource, das wichtigste Kapital des Unternehmens: den Mitarbeitenden. Auch das Gesundheitsmanagement wird als strategischer Erfolgsfaktor und als Chefsache gesehen, in dem die Resilienz des Einzelnen und des Unternehmens eine bedeutende Rolle spielt. Denn nur ein „gesundes“ Unternehmen ist auch in Zukunft ein innovatives, wettbewerbsfähiges Unternehmen.( Kuhlmann, H., Horn, S. (2020). Resilienz. In: Integrale Führung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26925-8_8 ).
Organisationale Resilienz ist somit gestaltbar und bedarf entsprechender Ressourcen zur Ausprägung der gewünschten Fähigkeiten. Die Ausprägung organisationaler Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit fordert einen Spagat zwischen Stabilität und Innovation, zwischen Effizienz und Flexibilität, zwischen Unternehmensvorgaben und Eigeninitiative.“ (Korge/Longmuß/Höhne/Bauer 2021: 3)
Im Kern geht es darum, das Potential der zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume gezielt zu erweitern und die erreichbare Handlungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Hier lohnt ein Blick auf etablierte Hochrisikoorganisationen, wie z.B. einen Kraftwerksbetrieb, die Feuerwehr, die Polizei oder den Rettungsdienst. Diese können durchaus als Vorbild resilienter Organisationen angesehen werden. Während eines Einsatzes kommt es immer darauf an, Unerwartetes schnell zu erfassen, zu bewältigen und gemeinschaftlich umgehend richtig zu handeln. Das ist nicht nur mittels Kontrolle bzw. technischer und organisatorischer Schutzwälle möglich, sondern bedarf der Schaffung von Strukturen und Routinen zur Reflexion vor, während und nach einer Handlung (eines Einsatzes).
Anpassungsfähigkeit benötigt Ressourcen, im Falle eines am Markt agierenden Unternehmens bedarf es eines sogenannten „organisational slack“. Unter “organisational slack” ist eine Überschusskapazität zu verstehen, welche durch organisatorische Entscheidungen und Gestaltungsmaßnahmen entsteht. Der Überschuss besteht v. a. darin, dass zum einen die organisatorische Struktur in ihren Möglichkeiten über das hinausgeht, was zur Verwirklichung der derzeitigen Ziele und Strategien notwendig ist, sowie dass zum anderen die Mitarbeitenden infolge der organisatorischen Regelungen Anreize erhalten, die über ihre Minimalanforderung hinausgehen. d.h. eines positiven Ressourcenüberschusses. Quelle: Glossar: Slack (personalmanagement.info)
Das nachfolgend skizzierte Beispiel beschreibt zwei Wege im Umgang mit der Corona-Situation, stellvertretend für vergleichbare komplexe Herausforderungen.
Ein starres Festhalten an bewährten Bearbeitungs- und Handlungsmustern in Verbindung mit der Unterschätzung einer kritischen Situation führt zwangsläufig zu Fehlentscheidungen, einer großen internen Betroffenheit von den Folgen des Ereignisses sowie dem Widerstand der Belegschaft im Hinblick auf die hektisch und zu spät getroffenen Entscheidungen.
Ein flexibler Umgang als Alternative, der die Entwicklung ernst nimmt und akzeptiert, auf kollektive Intuition setzt, indem unterschiedliche Perspektiven Berücksichtigung finden, z.B. durch die Etablierung abteilungsübergreifende Krisenstäbe, „auf Sicht segelt“ und regelmäßig kommuniziert, erscheint an dieser Stelle deutlich besser geeignet, um komplexe Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Komplexe Herausforderungen brauchen also flexible Lösungen (siehe Abbildung 1).


Abbildung 2: Kernfähigkeiten organisationaler bzw. systemischer Resilienz (Quelle: Fraunhofer Konzept für die Anwendung)
Dieser Ansatz setzt darauf, „Betroffene zu Beteiligten zu machen“, d.h. auf Schwarmintelligenz, Verantwortungsteilung und Selbstorganisation. Analog zur Hochrisikoorganisation erfordert dies ein entsprechendes Mindset sowie neue bzw. erweiterte Handlungsroutinen. Ein frühzeitiges Entwickeln, Probieren und Trainieren „im ruhigen Fahrwasser“ ist sinnvoll, bevor der Ernstfall eintritt. Die Ausprägung organisationaler bzw. systemischer Resilienz setzt auf die in Abbildung 2 dargestellten drei Kernfähigkeiten.
Dazu gehört erstens, schnell und flexibel auf unvorhersehbare Schocksituationen, wie Pandemie und Ukrainekrieg zu reagieren, um Auswirkungen zu minimieren und ausreichend Redundanzen zur Kompensation von Ausfällen und Vermeidung von Kaskadeneffekten herzustellen. Weiterhin gilt es zweitens, Stressfaktoren und Belastungen frühzeitig zu erkennen und proaktiv Maßnahmen einzuleiten – mit technischen, organisatorischen und Personal-Instrumenten, mit dem Ziel, Fähigkeiten zur fortlaufenden Anpassung an eine sich wandelnde Systemumgebung auszuprägen. Drittens braucht es Innovationsfähigkeit, d.h. nicht zurückfedern nach einem Schockereignis, sondern proaktiv agieren, aus Schocks zu lernen, sich kontinuierlich weiterentwickeln.
Wie bei einer sportlichen Beanspruchung braucht es nach jedem Schockereignis eine Regenerationszeit. In der Resilienzforschung gibt es unterschiedliche Phasen: Reorganisation, Stabilisierung und Wachstum. Nach einer Krise geht es darum geht, sich neu aufzustellen, Prozesse zu etablieren und beizubehalten. Wenn ich von einer Krise direkt in die nächste übergehe, dann funktionieren diese Phasen nicht. (Roth, F. : Systemische Resilienz bei Unternehmen | EY – Deutschland, 2020)
Isolierte Einzelmaßnahmen führen nicht zum Ziel. Erfolgversprechend erscheint ein holistischer Ansatz mit einer Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven und Kompetenzen, beginnend bei einer Resilienzanalyse. Diese tragen zu einer hohen kollektiven Selbstwirksamkeitserwartung und zu einem selbstbewussten Angehen von Herausforderungen bei.
Wie die Gesamtwirtschaft befindet sich auch der Automobilsektor in einem beispiellosen Umbruch. Themen wie autonomes Fahren, E-Mobilität und Systemvernetzung stellen die Branche vor große Herausforderungen, OEM´s wandeln sich immer mehr von Autoherstellern zum Mobilitätsdienstleistern. Damit werden klassische Geschäftsmodelle, bisherige Kernkompetenzen und Wertschöpfungsketten sowie erprobte Handlungsroutinen in Frage gestellt.
Überleben werden nur Anbieter, die Chancen und Risiken kalkulieren, sich weiterentwickeln und ihre Mitarbeitenden in diesen Wandlungsprozess in gewachsenen Strukturen integrieren.
Ziel der Autobranche ist es, sowohl die Produktion zu optimieren als auch eine verbesserte Nutzererfahrung – bei Mitarbeitern und Kunden – zu schaffen. Dazu brauchen Unternehmen digitale Plattformen, die eine sichere Zusammenarbeit gewährleisten. Resilienz bewegt sich damit aus dem „Nischendasein“ in Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Coaching heraus und fokussiert sich auf die Prinzipien und die Praxis der organisationalen Belastbarkeit.
Wie gelingt es nun ganz konkret, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit in der Unternehmensorganisation zu verankern?
Um betriebliches Lernen zu gestalten und Organisationen in lernende Systeme zu wandeln, bedarf es der Etablierung neuer Arbeitsmethoden, welche die Ausprägung der gewünschten Organisationseigenschaften unterstützen.
Als minimalinvasive Maßnahme eignen sich Workhacks. Sie sind eine vergleichsweise einfache Methode, um die Beschäftigten in Entscheidungen einzubeziehen bzw. sie selbstbestimmt ihre eigene Arbeitsweise verbessern zu lassen. Vergleichbar sind „Workhacks“ mit den bekannten “Lifehacks“, die sich auf Tricks und Kniffe beziehen, welche den Alltag erleichtern sollen. Der Hintergrund ist der gleiche, nur, dass sich diese Tricks auf das Arbeits- und nicht das Privatleben beziehen.
Workhacks können definiert werden als Methoden, um die Zusammenarbeit und Kommunikation von Teams verbessern. Mit Workhacks kann man schon an vermeintlich simplen und kleinen Details ansetzen, die auf konkrete Probleme projiziert werden. Sie zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie leicht und unmittelbar einsetzbar sind, ihre Einführung dauert in der Regel weniger als einen Tag. Außerdem sind sie höchst flexibel und können jederzeit an die Bedürfnisse des Teams angepasst werden.
Workhacks eignen sich ideal dafür, um eingefahrene Routinen und Abläufe, z.B. bei der Durchführung von Arbeitsberatungen, Teammeetings oder Dienstübergaben aufzubrechen. Aus zeitraubenden und ungeliebten Veranstaltungen werden damit kurze und wirksame Abstimmungen mit konkreten Vereinbarungen und wenn nötig, Protokollierung, die hilfreich für die eigene Arbeit und für die des Teams sind. Getreu dem Motto „Betroffene zu Beteiligten zu machen“, entstehen maßgefertigte Lösungen: „Es passt genau zu uns!“
Die Vorgehensweise ist einfach:
- Teams identifizieren unter Anleitung Potenziale und Probleme in der Zusammenarbeit.
- Die Kolleg*innen erarbeiten gemeinsam Lösungsvorschläge, um Kooperation und Kommunikation zu verbessern. Sogenannte Lernbegleiter*innen unterstützen als geschulte Personen das Team bei ihren individuellen Lernprozessen.
- Es wird erprobt, reflektiert und ggf. abgewählt, es ist agil. Was passt, wird gemacht. Andernfalls wird ein neuer Versuch gestartet.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Workhacks sind minimalinvasive Eingriffe in die Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit. Sie sind mit wenig administrativem Aufwand verbunden. Sie lassen sich schnell umsetzen, denn große Voranalysen oder Hintergrundinformationen sind nicht notwendig. Weil sie genau an den Problemen des Teams, das sie ja auch entwickelt, ansetzen und das Team sofort von der Lösung profitiert, sind sie besonders wirkungsvoll und nachhaltig. Außerdem brechen sie festgefahrenen Routinen auf und stärken die Reflexionsfähigkeit. Mitarbeitende trauen sich dann auch, nach und nach größere Probleme über ihr Team hinaus anzusprechen. Sie stellen außerdem kleine Experimente dar, sog. Mikro-Lern- und Experimentierräume: was passt, wird übernommen und wenn etwas doch nicht funktioniert, kann es verworfen werden.
Was ist ein Lern- und Experimentierraum?
Wer kreative Lösungen für den digitalen Wandel finden will, muss Neues wagen. Lern- und Experimentierräume sind als Umgebung für gemeinsames Ausprobieren und Voneinander-Lernen besonders geeignet. (Quelle: Was sind INQA-Lern- und Experimentierräume? – INQA.de – Initiative Neue Qualität der Arbeit)
Ein Lern- und Experimentierraum ist ein beteiligungsorientierter und zugleich innovativer Ansatz zur Optimierung von Arbeits- und Organisationsprozessen: Dabei legen Unternehmensführung und Beschäftigte gemeinsam fest, welches Problemfeld bearbeitet werden soll, z.B. Optimierung der Dienstplangestaltung, Neustrukturierung der Dokumentationsprozesse, Verbesserung der physischen Arbeitsbelastungen. Nach der Rollenverteilung im Team wird partizipativ und schrittweise nach Lösungen gesucht. In vordefinierten kurzzyklischen Abständen von ca. vier Wochen werden Zwischenziele ausgewertet und gegebenenfalls angepasst. So bedeuten Fehler keine Rückschläge, sondern der Weg zur Weiterentwicklung und Optimierung. Durch das gemeinsame Tüfteln der Beschäftigten an Lösungen ebnen sie den Weg zum „Arbeitsplatz der Zukunft“. Ein Lern- und Experimentierraum kann sowohl physisch vorhanden sein – also ein echtes Labor oder eine Werkstatt sein. Er kann – und das ist viel häufiger der Fall – sich im ersten Schritt um einen Beratungsraum handeln. Ein speziell präparierter Raum ist nicht notwendig. Als wichtige Voraussetzungen müssen jedoch Motivation und Ressourcen zur Verfügung stehen, um neuartige Aufgaben gemeinsam im Team anzugehen (siehe auch Abbildung 3).

Im Lern- und Experimentierraum sind verschiedene Rollen ähnlich wie bei der Scrum-Logik eines agilen Projektmanagements definiert. Der wesentliche Unterschied zu Scrum besteht darin, dass hier das Lernen im Vordergrund steht. Ein Lern- und Experimentierraum benötigt folgende Voraussetzungen:
- einen Lenkungskreis, bestehend aus zwei bis dreiPersonen: Geschäftsführung und Beschäftigtenvertretung als Entscheidungsgremium, verantwortlich für die Verallgemeinerung der Ergebnisse für das Unternehmen und Unterstützung des Labteams
- ein Lab-Team, bestehend aus 3-5 Beschäftigten (unterschiedlicher Abteilungen und Perspektiven) des Unternehmens, verantwortlich für die Arbeiten an spezifischen Problemstellungen und die Entwickelung gemeinsamer Lösungsansätze
- ein/e Lab-Teamverantwortliche/-r als Teil des Lab-Teams bei gleichzeitiger Verantwortung für die Überwachung der Aufgabenverteilung und -bearbeitung und als Koordinator sowie Ansprechpartner für Lenkungskreis und Projektbegleitung.
- eine externe Projektbegleitung, verantwortlich für die Befähigung des Labteam-Verantwortlichen und die Ergebnissicherung und Evaluation sowie als externe Unterstützungsfunktion
Zu Beginn der fünf- bis sechsmonatigen Zusammenarbeit erfolgt u.a. eine Verständigung des Labteams über eine gemeinsame Arbeitsteilung, die Festlegung von Kommunikationsregeln und -zyklen einschl. des Umgangs mit Feedback und Kritik im Team. Das Labteam bearbeitet die Aufgabe in drei- bis vierwöchigen Arbeitsphasen. Am Beginn und Ende jeder Phase erfolgt eine Abstimmung mit dem Lenkungskreis, dem zentralen Entscheidungsgremium. Dieses Vorgehen ermöglicht einen beteiligungsorientierten, kurzzyklischen und bedarfsgesteuerten Prozess unter Nutzung sozialer Dynamiken. Im besten Fall entfaltet der Experimentierraum eine strategische Hebelwirkung im Unternehmen. D.h., der Lern- und Experimentierraum wird zur neuen Arbeitsmethode im Unternehmen, die bei vergleichbar komplexen, betrieblichen Herausforderungen ohne Blaupause zum Einsatz kommt.
Ein Beispiel aus der Automobilindustrie eines betrieblichen Praxislaboratoriums zum „Flexiblen Einsatz in der Schicht“ bei der AUDI AG soll das illustrieren.
Im Rahmen des Labs haben Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen der Audi-Lackiererei in Ingolstadt – von der Fertigungskraft über Industriemechaniker*in und Fahrzeuglackierer*in bis hin zum/r Sachbearbeiter*in und zum Gruppenleiter – Lösungen zur Flexibilisierung des starren Schichtmodells in der Automobilindustrie erarbeitet und erfolgreich erprobt. Das gemeinsame Ziel: die Entwicklung eines zukunftsfähigen Arbeitszeitmodells, das auch in der getakteten Produktion die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und eine gendergerechte Arbeitsgestaltung ermöglicht. „Vor allem Frauen waren in diesem Projekt die Macherinnen“, Und sie haben sich für ein Thema eingesetzt, das keineswegs nur Frauen betrifft. Ein Praxis-Lab schafft mit seinen Prinzipien Agilität, Beteiligungsorientierung und Sozialpartnerschaft genau den richtigen Rahmen für nicht nur „Transformation“, sondern „Gestaltung“ des Umbruchs – auch in der industriellen Produktion.
Das Vorgehen hat zu folgenden Erkenntnissen geführt: Starre Schichtsysteme und individuelle Arbeitszeitflexibilität sind kompatibel. Die Lebenswirklichkeit der Produktionsbeschäftigten konnte weitreichend verbessert werden. Möglich gemacht hat dies ein interdisziplinär besetztes Lab-Team, das die weitreichenden und komplexen Herausforderungen und Auswirkungen des Arbeitszeitthemas ganzheitlich erfasst und erschlossen hat – von den Arbeitszeitwünschen der Mitarbeitenden bis hin zu personalpolitischen Regularien. „Dass Produktionsbeschäftigte ihre Arbeitszeiten in einem solch ergebnisoffenen Experimentierraum auf Augenhöhe mitgestalten können, ist Ausdruck eines gewaltigen Umdenkens, das den Weg weist in die agile Mitmachorganisation der Zukunft.“ (Quellen: https://idw-online.de/de/news791123, https://womendigit.de/audi-praxislab-dokumentation/ )
Als Fazit lässt sich festhalten: Um ein resilientes Team zu entwickeln, bedarf es folgender Grundzutaten:
- Ohne Teamspirit ist alles nichts! Dazu gehören gemeinsame Ziele, eine Vision und eine gesunde Portion Optimismus im Team, diese auch zu erreichen.
- Vertrauen gilt als Fundament. Dazu zählt das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern und auch in ihre operative Führungskraft. Nicht ohne Grund ist psychologische Sicherheit der wichtigste Erfolgsfaktor von high performing-Teams.
- Eine gesunde Fehlertoleranz ist erlaubt. Dazu gehört die Einsicht, dass Konflikte, Fehler und auch Scheitern sind ok und normal sind und von ALLEN gemeinsam konstruktiv gelöst werden. Fehler besitzen ein enormes Lernpotenzial, dieses wird aktiv genutzt.
- Sicherheit im geschützten Raum: Teammitglieder können offen kommunizieren, um Unterstützung bitten und erhalten diese auch vom Team.
- „Luftmachen“ und Dampf ablassen: Teams brauchen Orte und Gelegenheiten zum „Ausheulen“, aber die Teammitglieder können Rückschläge wegstecken und richten dann zügig den Blick nach vorne.
- Erfolge nicht nur im Keller feiern! Teammitglieder können sich über den eigenen Erfolg, den von Kolleg*innen und des ganzen Teams von ganzem Herzen freuen. Sie verstehen sich gut und feiern ihre Erfolge!
Der zweite ZdA-Podcast mit Herrn Kristian Schalter vom BDA widmet sich dem Thema „Future Skills und Resilienz“ Zentrum digitale Arbeit: Prisma der neuen Arbeitswelt. Der Podcast des ZdA (zda.xen2.de).